Intermusik 2/ 2004
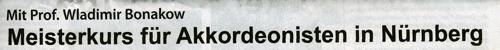
Eine
Reminiszenz von Gerhard Meyer
Nürnberg.
"Musik erlernen, nicht nur ein Instrument technisch beherrschen, die energetische
Einheit des menschlichen Körpers aktivieren, Physis und Psyche entdecken,
erschließen und nutzbar machen." So könnte man die Zielsetzung
des Meiserkurses für Akkordeonisten in der Hochschule für Musik in Nürnberg
im Dezember vergangenen Jahres unter der Leitung von Prof. Wladimir Bonakow aus
Moskau nennen.
Die ergebnisse internationaler Wettbewerbe führen zu der
Frage, ob Lehre und Praxis, Didaktik und Pädagogik der deutschen Akkordeonszene
im internationalen Vergleich bestehen können. An einigen Schwerpunkten des
Landes mag sich diesbezüglich einiges positiv bewegt haben.
Die Praxis
an den Hochschulen ist jedoch eher unübersichtlich und lediglich Insidern
bekannt. In der allgemeinen Unterrichtsliteratur wird diese These nur am Rande
behandelt, wenn überhaupt, und suggeriert dann weitestgehend Optimismus ...
"das machen wir mit links".
Man ist erstaunt, daß ausgerechnet
der kleine, aber auch feine Fachbereich der Musikhochschule Nürnberg unter
der Leitung von Irene Urbach sich bemüht, mentale Defizite zum Inhalt eines
Meisterkurses zu machen. Alljährlich werden Meisterkurse mit dem speziellen
Inhalt der Erweiterung mentaler Basisarbeit zur Lösung von Schwierigkeiten
beim Akkordeonstudium angeboten.
Prof. Wladimir Bonakow, als Komponist und
Bajan-Virtuose sowie als hervorragender Didaktiker und Pädagoge bekannt,
lehrt mit seinem Assistenten Iwan Sokolow den eher vernachlässigten Stoff,
holt ihn ins Bewußtsein (zurück). Wohl wissend, welche Kapazitäten
der Fachbereich anzubieten hatte, waren überwiegend Studenten osteuropäischer
Herkunft erschienen - unter ihnen überwiegend junge Damen.
Bei der heranwachsenden
Garde setzt sich hierzulande das Knopfinstrument, das Bajan-Ákkordeon,
gegenüber dem Instrument mit Klaviertasten nur langsam durch. Der offensichtlich
höhere Aufwand bei den Tasten-Instrumenten gegenüber den Knopf-Istrumenten
wird wohl gewohnheitsmäßig ausgeglichen (wie beim Beibehalten eines
nicht optimalen Fingersatzes).
Die Arbeitswoche wurde mit einem musikalisch
ausgesprochen beachtenswerten Konzert abgeschlossen. Von alter zu neuer Musik
reichte das Repertoire der beiden Virtuosen: von J. S. Bach (Badinerie, BWV 1066)
und D. Scarlatti (Sonaten), über Rachmaninow (italienische Polka) und Piazzola
(Libertango) bis zu Petri Makkonen (Flight beyond time).
Dezidiert artikuliert
Prof. Bonakow seine pädagogischen Prinzipien ganzheitlich: "Mensch und
Musik als Teile in der Kultur. Man lernt nicht ein Instrument, sondern Musik.
Psyche und Physis werden gleichermaßen angesprochen ...". So formulierte
er es auch in seiner Schrift "Überlegungen zur Kunst der musikalischen
Interpretation". Er postuliert "... beide Händer und alle Finger
einzusetzen. Die Verbindung ist physiologisch und psychologisch zu sehen. Wenn
wir beide Hände und alle Finger zusammennehmen, konzentrieren wir uns auf
unseren Willen, sind aufmerksam gespannt und zum Spiel bereit."
Für
den Solisten stellt sich da keine Frage. Hingegen ist der Orchesterspieler mit
seinem für gewöhnlich "einhändigen" Spiel durchaus angesprochen.
Die "stille" Linke ist auch irgendwie verschenkte Musik, abgesehen von
der vernachlässigten Kleinmotorik (ergonometrische Verkümmerung) der
Spielerhände.
Die Russen haben das "Volksinstrument" Akkordeon
zum vollwertigen Konzertinstrument entwickelt. Während man dort das Bajan-Akkordeon
(mit Konverter-Technik und Melodiebässen) vervollkommnete, konnte man andernorts
- in Deutschland - den Standpunkt vertreten sehen, daß die Leute jene Instrumente
spielen sollen, die "wir" bauen.
Vielleicht bewältigen die von
der traditionsreichen Firma aus Trossingen gesponserten Musiker in St. Petersburg
das Problem der linken Hand im Orchester, oder landen bei "Soundvariations"
und Jazz und Pop. Notenkenntnisse nur eingeschränkt notwendig, von Elektronik
und gesundheitsgefährdenden Lautstärken gekennzeichnet. Eine Paralysierung
der Kultur, marktwirtschaftlich bedingt. Billigen wir mildernde Umstände
zu. Es könnte aber auch ein kompositorisches Problem sein. Wie wäre
es mit einem Komponistenwettbewerb, finanziert durch den musikalisch-kommerziellen
Bereich?
Festzustellen ist, daß die Unterschiede zwischen Ost und West
ganz erheblich sind. Man hatte es dort aber auch leichter ... Dort wurde ganzheitlich
geplant: Arbeit am musikalischen Werk und Entwicklung einer persönlichen
Beziehung zum Werk, Notenliteratur, Instrumentenbau, Didaktik und damit auch die
Persönlichkeitsbildung der Musikanten. Dort wurde die gesetzliche Ehe zwischen
westeuropäischer Fuge und dem russischen Volkslied in Aneignung von Generation
zu Generation in Übernahme von Erfahrung und Verarbeitung dekretiert (Friedrich
Lips). Die Komponisten wurden angewisen, keinen anderen musikalischen Stil zu
verwenden, der avancierter sei als der des Sergej Rachmaninow. Der war zwischenzeitlich
nach Amerika emigriert. Damit wurde gleichzeitig die Freiheit der Komposition
eingeschränkt und ein Riegel gegen "antikünstlerische" Musikliteratur
von schablonenhaften, analphabetischen Bearbeitungen von Volksmelodien, primitiven
Auslegungen bekannter Komponisten oder Stücken wenig professioneller Komponisten
vorgeschoben" (Bonakow). Und war von Erfolg gekrönt.
Instrumentenbau,
qualifiziertes Lehrpersonal, spezielle Lehrmethoden für Akkordeon, Lehrspielstätten:
Man konnte und kann sich auch heute einen strenge Prüfungsauslese leisten.
In Deutschland vorwiegend als absatzträchtige Massenobjekte im Kontext einer
ökonomisch-firmenpolitischen Entwicklung (Thomas Eickhoff 1991) behandelt,
ist heute der bestehende Bruch (Schmülling) kaum zu heilen.
Ziele wie
Lernstoff und Intensität eines Meisterkurses unterscheiden sich nicht unwesentlich
von dem, was der Laienmusiker im Alltag betreibt. Von den Ausbildungsstätten
geht die Vervollkommnung der Musik aus.
Der musikalisch Interessierte musiziert
in Gruppen, Orchestern, fügt sich ein in ein allgemeines Leistungsvermögen,
verhält sich gruppenkonform (fällt manchmal unangenehm auf, hat geübt).
Gruppen bilden denn auch oft die wenig effektive Form der Aus- und Weiterbildung
mit kleinstem gemeinsamen Nenner. Das Bemühen der Harmonikaverbände
um neue didaktische Verfahren, Stile usw. ist evident. Es ist eingebunden in die
allgemeinen kulturellen Bedingungen. Und ob sich beabsichtigte allgemeine Multiplikator-Effekte
erzielen lassen, hängt von den Teilnehmern der veranstalteten Seminare ab.
Den
Überlegungen zur musikalischen Interpretation von Prof. Bonakow kann man
hier flächendeckend nur in Einzelfällen gerecht werden. Insoweit: Deutschland
ein Entwicklungsland, "Pisa" läßt grüßen. "Es
wird nichts gegeben, wenn ich bloß bequem und erleichtert mitschwinge"
(Ernst Bloch), "Gemütserlustigung hat vorausgegangene Mühe zur
Bedingung" (Jean Paul).
